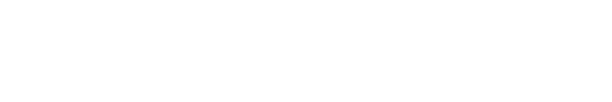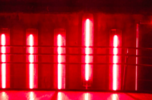Münchner Kontinuitäten Mara Käser, 09.06.16
Der 2. Weltkrieg hat so manchem Komponisten nicht geschadet, insbesondere wenn er mit den Nationalsozialisten sympathisierte und seine künstlerische Kompetenz in ihren Dienst stellte. Hans Carste zum Beispiel, der 1941 das Sturm- und Marschlied der Propaganda-Kompanien komponierte und dessen Fanfarenfragment aus der „Hammond-Fantasie“ seit 1956 im Vorspann der Tagesschau zu hören ist. Oder auch Werner Egk, der 1941 den Marsch der deutschen Jugend sowie die Filmmusik zum Propaganda-Film „Jungens“ schrieb und 2001 von Edmund Stoiber als „markante Persönlichkeit“ bezeichnet wurde. Es zeugt von Selbstreflektion, dass die Carl-Orff-Stiftung den Kompositionsauftrag an Genoël von Lilienstern der Landeshauptstadt München finanziell förderte, da auch ihr Namenspatron dem rassistischen Aufruf nachkam, eine Ersatzmusik für den Mendelssohn'sche Sommernachtstraum zu komponieren.
Dramaturgisch ist der zweistündige Abend, der wie im Flug vergeht, wie ein Memory-Spiel aufgebaut: zu jedem „Objekt“ vor 1945 gibt es ein Gegenstück nach der Stunde Null. „Speere Stein Klavier“ fokussiert sich auf die Kontinuitäten der Diktatur der Nationalsozialisten in Musik, Kunst und Architektur im Deutschland der Nachkriegszeit bis in unsere Zeit hinein – mit einem speziellen Fokus auf München. In einem virtuos inszenierten Zusammenspiel von Schauspiel und Gesang entfaltet sich ein Abend mit diskursiver Wucht. Die Grundlage bilden 999 Dokumente, die in über zwei Jahren gesammelt, gesichtet und ausgewertet wurden. Das Regieteam mit Regisseur Christian Grammel, Dramaturgin Elisabeth Tropper sowie der Bühnen- und Kostümbildnerin Yassu Yabara haben in Zusammenarbeit mit Komponist von Lilienstern ein Stück Zeitgeschichte auf die Bühne gebracht, das nicht nur das unreflektierte Übernehmen kultureller Erzeugnisse in Frage stellt, sondern auch die Kunstform Oper um selbstreflexive Elemente bereichert. So singt der Chor in absurd-witziger Haltung und Sprachformung Teile sogenannter „Dokumente“ – Behördensprache im Falsett.
Der Fluss erwartet Sie / sie Mara Käser, 09.06.16
Fluss warten la-a-a-a-a-ng
Leise Unruhe da kommen sie
Er im Suchen sie immer zu zweit
Rausch Rauschen Stille
Ein Fahrrad kreuzt die Dunkelheit
Euridike erleuchtet
Dunkelheit
Fluss warten verfolgen wir sie
Im Dunkel tritt der Vogel ins Nichts
Orpheus nur im Kreis
Die Liebste perdu
St-i-i-i-i-i-i-imme Puls Glitzer
Eindrücke zu Phone Call to Hades, Uraufführung 31.05.2016 – Theaterakademie August Everding
Gut, besser Paulaner ... Jaš Otrin, 05.06.16
Es hat 33 Grad und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Man würde meinen, man ist irgendwo in den Tropen. Ein Glas Kühles würde sich anbieten. Ab das geht ja nicht. Wir sind im Müllerschen Volksbad bei einer Vorstellung und der Junge, der sicher auch Durst hat, darf auch nichts trinken. Er ist dabei, über die Grenze zur Eigenständigkeit zu singen. seine Freunde sind noch nicht so weit. Sie planschen noch kindlich unten im Becken. Er aber steht schon oben; bereit, den Sprung ins „richtige“ Leben zu wagen. Aber was ist das, das richtige Leben? David Foster Wallace konnte es leider nicht richtig er(aus)leben, auch wenn er, so sagte er selbst, eine glückliche und behütete Kindheit hatte. Der Junge aus dem Volksbad hat die nicht. Seine Eltern sehen nur sich selbst im Mittelpunkt. Aus der Masse des Chores im Becken, der das ganze Volksbad akustisch erzittern lässt, versucht er ständig über die Höhen des Registers alle zu übersingen. Erst als es zu spät ist, merken die Eltern, dass sie dabei sind, ihn zu verlieren und schwimmen kreisend um seine „Insel“ herum, um ihm den Fluchtweg zu versperren. Am Ende sitzt er wieder oben, alleine und fernab von seinen Freunden. Es sieht nicht so aus, als ob er sich seine neu gewonnene Eigenständigkeit so vorgestellt hat.
Nun aber schnell Nachhause zu meiner Tochter. Hoffentlich erwische ich Sie noch wach, um ihr einen Gute Nacht Kuss zu geben.
Ihr dürft gerne mitmuhen! Caroline Ziegert, 05.06.16
Ein Probenbesuch bei Speere Stein Klavier am Theater Augsburg
Was macht ein praktisch veranlagter Regisseur wie Christian Grammel, wenn mitten in der Probe plötzlich ein Theaterwissenschaftsprofessor und seine zehn Notizblock zückenden Studentinnen und Studenten ihre Nasen zur Tür hereinstecken? Richtig, er zapft sie gleich als Stellvertreter für den fehlenden Chor als Ressource an! Kurzerhand ordert er unsere Gruppe - Professor Roesner bleibt verschont - in ein hölzernes Kabuff am Bühnenrand, aus dem wir nach und nach in Zeitlupe auf die Bühne steigen dürfen, um mit abwesenden Blicken und neugierigen Händen die dort aufgehäuften historischen Artefakte abzutasten. Eben in apathischer Zombiemanier, wie manch ein Zuschauer die Bayreuther Festspiele verlasse, erklärt Grammel veranschaulichend.
Wie besorgte Antiquare drängen sich die Darsteller von Speere Stein Klavier erfolglos zwischen die von den Eindringlingen untersuchten Gegenstände. Diese Aktenkisten, Kunstobjekte und Möbel stammen aus der Recherchearbeit zu Münchner Künstlern, deren Biographie und Werk zur NS- und in der Nachkriegszeit Kontinuitäten aufweisen. Neben die greifbaren Quellen gesellen sich im Stück neutral präsentierte, nicht sofort kontextualisierte Texte und Musikstücke von Komponisten wie Carl Orff und Werner Egk. Mehr, als eine Wertung vorzunehmen, interessiert den Komponisten Genoel von Lilienstern die Wiederkehr ästhetischer Merkmale, weshalb er für das Musiktheaterstück musikalische „Zwillingspaare“ aus beiden Zeiten einwebt.
Immer wieder entwickeln sich längere Szenen, die durch die nahtlos überfließende Musik nahezu filmisch ineinander überblenden. Zum Beispiel, wenn am Ende einer Schützengrabenszene, deren gesprochener Text bei der Probe sehr exakt vom Korrepetitor dirigiert wurde, bereits Kuhglocken für die nächste erklingen. Hier dürften wir Studenten sogar gerne mitmuhen, ermunterte Grammel. Dieser Probenbesuch war auf jeden Fall kein langweiliger und zu meiner Freude gab es noch genug Möglichkeit zum distanzierteren Betrachten aus Zuschauerperspektive und ein ausführliches Gespräch mit Komponist und Regisseur sowie Dramaturgin Elisabeth Tropper.
Das junge Team hinterlässt mich mit ihrer gar nicht trockenen Untersuchung des immer noch aktuellen Themas von weiterexistierenden rechten Überbleibseln in Politik und Kultur gespannt auf die Premiere am kommenden Sonntag, den 5. Juni, die um 20.00 Uhr stattfinden wird. Ob der Chor dann auch zur Kuhherde mutieren wird?
Der Herzog, der spinnt ... Jaš Otrin, 05.06.16
der Tag war verregnet und wie üblich war ich spät dran. Als ich „an Deck“ ging, haben mich als allererstes (projizierte) Schicksalsweberinnen an den Wänden begrüßt, als ob sie mir sagen wollten: hier und jetzt wird mir gezeigt was war und was sein wird.
Am „Achterdeck“ stand der Dirigent, der wie ein Trommler den Takt an die Ruderer (Orchester) vorgab. Die Darsteller waren über dem gesamten Publikumsbereich verstreut, was den Eindruck vermittelte, man befände sich „mittendrin, statt nur dabei“. Als sich das Schiff dann endlich anfing zu bewegen, wurden ausgewählte Ausschnitte aus Fitzcarraldo auf die Wand projiziert. Durch das ständige Vor- und Zurückspulen der Clips wurde die Assoziation zahlreicher Rückschläge bei der Eroberung erweckt. Die Protagonisten waren verkabelt, wodurch mir manchmal nicht klar war, wer jetzt denn genau spricht. Ob Kinski auch darunter war?
Das Highlight des Abends ist konzeptuell so naheliegend wie genial; Szenische Elemente aus Metall wurden als Maste dargestellt, hatten dabei aber auch eine praktische Komponente. Sie funktionierten nämlich gleichzeitig auch als Streichinstrumente, die so einen gänzlich neuartigen Resonanzkörper erlebbar machten.
Fitzcarraldo „had a dream“! Caruso hat zwar nie auf seinem Schiff gesungen. Aber es zeigt uns, wie auch immer der Traum verrückt sein mag, man muss daran glauben, dass er wahr wird und darf niemals aufgeben.
Nutzlos wurde dann am Ende nur mein Regenschirm, denn es hatte aufgehört zu regnen.
Follow the artist Kornelius Paede, 04.06.16
Also, ich warte vorhin am Stachus auf die Tram, da kommt so ein Verrückter vorbei und flüstert mir ins Ohr “Glaub ihnen nicht” - und ich dachte mir, dass das doch bestimmt ein guter Aufhänger für einen Blogbeitrag wäre, aber dann dachte ich mir, dass mir das doch niemand glaubt, so einen pfarrerspredigtartigen Einstieg, also lassen wir das, obwohl ich bestimmt einen herrlichen Zusammenhang zur Biennale herkonstruiert hätte. Jetzt schreibe ich einen flapsigen Blogeintrag über ein Heute, das eine Konstruktion meiner Suche nach Zusammenhängen ist (und das geht so):
Ich war vorhin in “Mnemo/scene: Echos” und dachte mir, dass man am besten Stephanie Haensler oder Yvolle Leinfelder nachlaufen sollte, die sich unter’s Publikum gemischt hatten, weil die doch bestimmt dahin gehen, wo sich die Installation gerade verdichtet, hab mich aber doch dagegen entschieden, weil es doch ein bisschen awkward wäre, dauernd jemandem nachzulaufen, der viel Arbeit damit verbringt, etwas zu bauen, in dem ich mich frei bewegen kann. Und ich war zeitweilig ganz beglückt vom diesem sehnsuchtsvollen romantischen Idiom, das mal eben so nebenbei den ganzen bierernsten Diskurs über Materialstand für eineinhalb Stunden entsorgt - und das trotzdem nicht restaurativ wirkt.
Ich war vorhin im Symposium zur Biennale und hatte (durch Vorträge über Robert Walser, Marthaler und Häusermann) den Eindruck, dass für das zeitgenössische Musiktheater besonders am heutigen Tag die Schweiz ganz maßgeblich ist. Daniel Ott ist ja Schweizer, natürlich. Und Stephanie Haensler doch auch, oder? Und auf einmal steht da jemand den ich kenne und arbeitet mittlerweile an der Oper Basel. Da hat der Tag eine Überschrift, doch ich habe kein Verhältnis zur Schweiz, weil ich behaupte, kein Verhältnis zu Nationalstaaten zu haben, was natürlich nicht stimmt.
Ich sitze an der Tramhaltestelle und schreibe einen Blogeintrag über das Heute, an dem sich die Frage nach Medialität nicht mehr so arg stellt, die Frage nach romantischer Harmonik ein bisschen mehr - und die Frage nach der Schweiz wäre vielleicht zu stellen, ist mir aber unbekannt.
Vom Quietschen der Schweine, oder: Was ist eigentlich Musik? Iseult Grandjean, 03.06.2016
„Der Georg hat sich in den Fuß geschossen“. Das Publikum lacht verhalten, als wüsste es selbst nicht so recht, was daran lustig ist. Aus solchen Sätzen, kurz und kraftvoll wie hochprozentiger Schnaps, drückt Arno Camenisch sein Erstlingswerk „Sez Ner“, in dem er das Leben auf der Alp in Versatzstücken beschreibt; es geht um Kühe und Schweine, die sich gegenseitig das Blut von den Nasen lecken. Es geht um Sonne, die sich morgens über die Berge hievt und nachmittags lange Schatten ins Tal wirft. Es geht um Zwetschgenwasser und Käselaibe, die im Keller lagern „wie Goldbarren“. Es geht um Wind und Frau und Mann im Wald. Es geht um das nackte Leben.
Ein Donnerstagabend in München; voller Regen, der sich wahrscheinlich wie in „Sez Ner“ irgendwo gegen die Alpen drückt, als wollte er sie auswringen. Wir sitzen in der Black Box im Gasteig und hören dem Mann im schwarzen Hemd und den flachen Turnschuhen zu, den man sich so nur schwer vorstellen kann als Hirte, bis zu den Knien in Kuhscheiße. Aber dann doch: Denn Camenisch liest nicht, er trägt vor. Performt. Hat eine Stimme, die auf den Berg passt, tief und kreidig. Ein alpiner Bass. Beinahe wie ein kehliger Mönchsgesang, wie Musik. Aber strenggenommen eben auch nicht. Es gibt keine Instrumente. Auf meiner Eintrittskarte steht „Lesung“. Und damit ist diese Biennale auch eine, die Grenzen verschwimmen lässt: Was ist Musiktheater? Was ist Musik?
Folgt man einem akribischen Schema, fallen unter den Begriff Musiktheater im weitesten Sinne alle Formen, die dramatische Handlung mit Musik verbinden. Im anschließenden Stück der Doppelvorstellungen, Georges Aperghis „Pub – Reklamen“, imitiert Donatienne Michel-Dansac, eine kleine Französin mit Garçon-Schnitt, verzerrte Fetzen aus Werbungen, sie spricht und flüstert, sie macht alles Mögliche mit ihrer Stimme, sie quietscht und pfeift, surrt und schnalzt. Sie singt. War das ‘mehr‘ Musik?
Wo ist die Schnittstelle zwischen Geräusch und Musik, zwischen bloßer Stimme und Gesang? Vielleicht entsteht sie, als imaginärer Raum, als Nicht-Ort, nur, wo solche Fragen meist enden: im Rezipienten. Denn die Teile aus „Sez Ner“ evozieren, nicht zuletzt durch den doppelten Vortrag auf – für die meisten Zuschauer unverständlichem – Rätoromanisch eine Barthes’sche Lust am Text, die über das Signifikat hinausgehen; man verliert sich in den Wörtern wie ein Wanderer im Wald und meint es, fast zu hören: das Quietschen der Schweine, die zuckenden Blitze, die Schaufel, die über die harte Gebirgserde kratzt. Auch das ist Musik.
Erinnerungslandschaft Angelika Endres, 02.06.16
Zeit.
Ein Echo.
Deine Worte.
Wildnis. Nachbargarten. Zehenspitzen. Porzellanelefant. Vergessene Gegenstände. Tönende Umarmung. Begebenheiten. Erinnerungslandschaft.
Worte, die verwischen.
Figuren, die verschwimmen.
Töne, die erklingen.
Eindrücke, die bleiben.
Eine Erinnerung.
Flüchtig.
Eindrücke der Generalprobe von Mnemo/scene: Echos im Einstein Kultur. Uraufführung: Do, 2.06.16
3 mal a, 1 mal d, 1 mal e, 1 mal f, 4 mal h, 2 mal i, 3 mal n,... Patricia Stainer, 31.05.16
In den ersten fünf Minuten von if this then that and now what wurde mir klar, dass ich darüber einen Blogartikel schreiben würde, der mit genau diesem Satz anfängt. Das einzige Problem ist: Wie soll man das Werk von Simon Steen-Andersen, das sich zwischen Theater, Lecture Performance, Konzert und Lichtshow bewegt und auf der Münchener Biennale 2016 Premiere feierte, treffend in Worte fassen?
Wenn ich als Blog Schreibende darüber reflektiere, dass ich jetzt gerade einen Blog schreibe, dann ist das in etwa das Gleiche, als wenn ein Darsteller in itttanw darüber reflektiert, dass er lediglich ein Schauspieler ist, der gerade einen auswendig gelernten Text vorträgt.
Selbstreflexion ist das große Thema, dem sich die vier Schauspieler und achtzehn Musiker widmen. Dabei geht es unter anderem auch um das Verhältnis von Musik und Text und von Klang und Bewegung: Wenn die Streicher ihre Saiten mit dem Holzteil des Bogens in einstudierten und synchronisierten Bewegungen in einer Art Tanz zum Klingen bringen, was bedingt dann was, die Bewegung den Klang oder umgekehrt?
Und apropos Synchronisation: Wenn zwei Darsteller denselben Text gleichzeitig sprechen, mag dies zunächst sinnlos wirken. Doch wenn die Darsteller leicht zeitlich verschoben denselben Text sprechen, erreichen wir als Zuhörer einen Schwebezustand, in dem es uns gelingt, trotzdem beiden zuzuhören – so lange bis die Verzögerung zu groß wird und wir uns nur noch auf einen Sprecher konzentrieren können. Und auf genau dieses Phänomen werden wir im selben Moment von den Sprechern hingewiesen und ertappen uns dabei, wie es uns gerade passiert.
So ähnlich, wie wenn ich Sie als Leser jetzt darauf aufmerksam mache, dass Sie gerade den Text eines Blogartikels lesen.
Womit zudem bewiesen wäre, dass auch Texte über sich selbst reflektieren können. Eine alternative Möglichkeit über einen Satz zu reflektieren wäre beispielsweise, wie wir im Stück erfahren, in Form eines „Autograms“ einfach nur die Buchstaben aufzuzählen, die darin verwendet werden. Wie ich es mit dem Titel if this then that and now what in der Überschrift dieses Beitrages begonnen habe.
Ich denke, Sie haben das eben kurz überprüft.
Würden Sie der Frau mit der Anticlock vertrauen? Bernardo Sousa de Macedo, 01.06.16
Das Festival vor dem Festival ausprobieren zu können — was für ein schönes Gefühl. Ich bilde mir ein, es gibt kein besseres Gegengift für die Angst, etwas zu verpassen, eine Angst, die die meisten Theaterfans verbindet.
Anticlock. Samstag. 20:00 Uhr. Ich darf an der GP mit Probepublikum teilnehmen. Ich und sechs weitere Herrschaften, treffen uns vor dem Gasteig und werden von Malte Ubenauf empfangen. Dass wir gleich eine gemeinsame Reise im wahrsten Sinne des Wortes unternehmen würden, weiß zu diesem Zeitpunkt noch keiner von uns.
Die Gruppe wird plötzlich von einer fremden Frau angesprochen. Sie will uns etwas zeigen. Aber wer ist sie? Eine verwirrte Obdachlose? "Kommen Sie mit!", ruft sie. Die Gruppe folgt ihr.
Zehn, zwanzig Minuten lang begleiten wir diese Frau. Sie läuft rückwärts, spricht und führt die Gruppe an. Sie spricht mehrmals, fast obsessiv, von einer gewissen Anticlock. Anticlock? Das könnte zu einem Werbespot mit Jane Fonda passen. Hier geht es aber nicht um Coenzym Q10 und andere leere Versprechen der Kosmetikindustrie.
Gut, sie will uns nichts verkaufen. Aber was genau will sie von uns? Es ist noch zu früh, um das herauszufinden. Sie scheint momentan auch noch damit zufrieden zu sein, dass wir ihr folgen und ihr zuhören. Das machen wir, und zwar mit erstaunlich blindem Vertrauen.
"Sie sind rückwärts gegangen, die ganze Zeit."
"Ihre Zeit ist abgelaufen, sind sind einfach davon gelaufen, so wie ich. Einfach weggegangen"
Unser Guide konfrontiert uns mit diesen und anderen Reflexionen über die Zeit. Und vieles klingt plausibel, klug und schrecklich wahr. Nur der Kontext erscheint uns seltsam. Es ist als ob man sich nachts um sechs, völlig betrunken, an einem heruntergekommenen Imbiss mit einem völlig Unbekannten über den Sinn des Lebens unterhält. Auf einmal bekommt man erstaunlich Kluge Dinge zu hören, die man nicht so recht glauben mag.
Wir sind also verwirrt. Und wir wissen gar nicht, dass wir gleich noch viel verwirrter sein werden, denn jetzt beginnt die eigentliche Reise mit der Anticlock. Mehr darf ich, will ich nicht verraten. Die Zeit ist jedenfalls ein sonderbar Ding. Und wenn eine Anticlock dazu kommt, kann es nur noch sonderbarer werden.
Ich hatte den Plan, einen Blogbeitrag zu schreiben Angelika Endres, 31.05.16
Ich hatte den Plan, einen Blogbeitrag zu schreiben, und er sollte mit diesem Satz beginnen. Das Problem war: Wie soll es danach weitergehen?
Mein Versuch, Simon Steen-Andersens Ansatz zur Selbstreferentialität im Musiktheater auf meinen Schreibstil anzuwenden, scheitert einerseits und steigert andererseits nur meine Begeisterung für die Vorstellung If this than that and now what. Nach 120 kurzweiligen Minuten frage ich mich, was ich da eigentlich erlebt habe: eine Lecture Performance, eine Installation, eher ein Konzert oder doch ein Theaterstück? Ohne diesen Begriff mit dem dänischen Autor, Komponisten, Regisseur und Bühnenbildner abzustimmen, nenne ich es eine Musiktheater-Choreographie: Akribisch exakte Schritte von großen, in Anzüge gekleideten, langbeinigen Herren werden von Lichteffekten begleitet und beeindruckend real vertont. Überdimensionale Dominosteine, Tischtennisschläger und ein Akkuschrauber erzeugen ebenso Musik wie Posaunen, Streich- und Schlaginstrumente. Perfektion scheint nicht nur oberstes Gebot, sondern auch implizite Selbstverständlichkeit zu sein. Das Dekonstruieren von und Referieren über Kausalität erfrischt, wird komisch und nahezu poetisch. Musik und Text werden voneinander getrennt – und erst dann erscheinen sie unmittelbar miteinander verknüpft und nicht einander aufgesetzt.
Keine Beschreibung wird dieser Biennale-Produktion gerecht, versucht sie doch, so wenig konkret wie möglich zu sein. Denn: „Musik kann einem ganz leicht durch die Finger flutschen.“
Ich war in Brasilien Mara Käser, 31.05.16
Erste Eindrücke von den SHOTS – Ein Vermittlungsformat nach Vorstellungen der Münchner Biennale in der Muffathalle durch MA-Studierende der Theaterwissenschaft an der LMU München
Draußen schüttet es, deswegen die erste Planänderung: die SHOTS werden wir im Gang zur Muffathalle machen. Tische werden aufgebaut, Wodka und Säfte deponiert und für unsere Gäste Gläser gestapelt. Nun kann es losgehen! Nach der Vorstellung von Sweat of the Sun (SotS – die Ähnlichkeit ist nicht ungewollt!) schnell aus dem Zuschauerraum geflitzt und ran an die Tische: „Guten Abend, wollen Sie einen Schnaps mit mir trinken?“ – das Publikum muss aufmerksam gemacht werden auf uns, wie wir da so mit unseren Getränken mitteilungsfreudig stehen. Die ersten Interessierten oder besser Wagemutigen gesellen sich zu uns. Drei Minuten haben wir mit jedem Gast, die Uhr tickt neben unseren Gläsern. Dann mal Prost! Und bitte, was haben Sie gesehen? Denn das ist der Deal – ein Shot gegen einen Seheindruck. Es ist spannend zu beobachten, auf welche Theatermittel die Zuschauer und Zuschauerinnen reagieren: es wurde viel über die Bühne gesprochen, über das dominante Grün einer möglichen Green-Box oder des Urwaldes, die Form der Zuschauertribünen als Schiff und über das Kammerorchester als treibende Kraft im Maschinenraum. Auch zeigten sich einige Gäste beeindruckt vom Zusammenspiel der einzelnen Theatermittel vor allem im ersten Teil der Aufführung. Unsere zwei Tische sind gut besucht, einzelne Gäste machen wiederum andere Zuschauer und Zuschauerinnen auf uns aufmerksam. Nun spielt uns der Regen doch in die Hände, denn der Gang ist gut gefüllt nach der Vorstellung, da draußen keine sonnige Alternative wartet. Der Regen inspiriert dann auch zu einigen Urwaldgesprächen, zum Abwägen der Vor- und Nachteile des Einzelurlaubs im brasilianischen Dschungel sowie einer kleinen Lesung aus dem Tagebuch „Eroberung des Nutzlosen“ von Werner Herzog. Schön wars!
SHOTS – wieder am 4.6. nach "HolyVj#Digression n°1" und am 8.6. nach
"Underline"; Bei Regen im Gang der Muffathalle neben dem Muffatcafé, bei schönem Wetter draußen vor der Halle.
Halli Galli Auftakt? Kornelius Paede, 29.05.16
Einen kurzen Augenblick fragt man sich vielleicht schon, ob die sog. Halli Galli Drecksound-Party im Muffatwerk Teil des offiziellen Programms ist. Die findet nämlich zeitgleich zur Eröffnungsfeier der BIennale nur ein paar Meter entfernt im Muffatwerk statt. Aber das fragt man sich nur einen wirklich kurzen Augenblick, trotz allen Ironie- und Irritationsmöglichkeiten zeitgenössischer Kunstpraxis, denn der erste Biennaletag unter neuer Indendanz gibt sich in den ersten 24 Stunden erstaunlich unaufgeregt. Weder der fahrige Stallgeruch manch anderer Szenetreffen ist wahrzunehmen, noch hektisches Herumgewusel zwischen Bier und Buffet bei der offiziellen Eröffnungsfeier - trotz vollem Haus. Stattdessen ruhige Erwartung und entspannte Gespanntheit auf das, was da noch kommen mag. Womöglich vergleichbar mit den Rezeptionsmodi, die sich auch bei Kompositionen der beiden Intendanten einstellen, sobald man sich auf deren Umgang mit Prozessualität, Materialität und Atmosphäre einlässt. Der Biennale-Auftakt fühlt sich gleichsam subtil gestaltet an, ohne dass die dazugehörigen Mittel ausgestellt wären.
Arbeitsames Tun als Understatement auch in der Generalprobe zu Hundun, wenn Judith Egger und Neele Hülcker ein gewaltiges Ungetüm seriös beforschen - und die scheinbaren klanglichen Nebenprodukte dieser Tätigkeit auf einmal anfangen, Geschichten zu erzählen und den starren Korpus beleben, der inmitten von Studio 1 aufgehängt ist. Lässt man sich auf diese Klänge ein, verselbständigen sie sich so stark, dass die gewaltige Installation urplötzlich mehr ist als die Projektionsfläche, als die man sie anfangs womöglich noch im Verdacht hat. Zugunsten dieser Atmosphäre verschwinden Fragen nach Intention, Komposition und Zufälligkeit - vielleicht ähnlich, wie bei den Staring at the Bin-Aktionen von Meriel Price & Co. Hier wird der öffentliche Raum durch beinahe unmerkliche Interventionen bereichert, die auch als kuriose Alltagserfahrungen durchgehen könnten. Subversiv womöglich, vielleicht im hintersten Winkel auch romantisch gedacht, jedoch niemals eindeutig.
Kein Wunder also, dass die Atmosphäre bei der Eröffnungsfeier so ist, wie sie ist. Halli Galli fühlt sich deutlich weiter weg an, als nur 20 Meter Luftlinie entfernt. Von drüben wummern zwar die Bässe und eigentlich könnte man später noch hinübergehen. Aber wieso sollte man?
Sweat of the Start Carmen Kovacs, 28.05.16
Freitag, früher Nachmittag am Muffatwerk. Am Tag der Generalprobe liest sich Sweat of the Sun als Kommentar – im Schatten des Biennale-Containers auf dem Vorplatz wird trotzdem geschwitzt. Manos Tsangaris lehnt am Geländer vorm Eingang, sieht entspannt aus. Auf dem Pappbecher in seiner Hand, aus dem wohlgemerkt Tee und nicht Kaffee getrunken wird, steht sein Name. Nicht Hochmut, sondern Nachhaltigkeit. Ein paar wenige, aber wichtige Menschen der Biennale haben sich versammelt, um die Probe zu sehen. Erst einmal aber, um gemeinsam zu warten. Denn wie das immer so ist, beginnt alles mit einer sympathischen Verzögerung. Auch drinnen wird also geschwitzt. Draußen kühlt der Sound der quasi hauseigenen Wasserschleuse den Kopf durch weißes Rauschen und stimmt uns ein auf Bilder von Wassermassen und Schiffsmotoren. Bilder, die wir sofort im Kopf haben, wenn wir an Werner Herzogs Fitzcarraldo denken – der Film, aus dessen Material sich das Stück, das wir gleich sehen werden, im weitesten Sinn entsponnen hat. Ebenfalls als Material und sogar Libretto wurden Herzogs Tagebuchaufzeichnungen, die während des Drehs entstanden sind, verarbeitet. Klaus Kinski hat Anfang der 80er dem Fitzcarraldo seinen Größenwahn geliehen (oder war es andersrum?) und mit dem Schiff über den Berg ein Symbol geschaffen, das noch heute für das Überwinden von Grenzen steht. Denn sein Plan, ein Opernhaus im Dschungel zu errichten, ist ein starkes Stück, eine Wahnsinnsidee, die nur aus der flimmernden Hitze, dem sumpfigen Wasser und der drückenden Schwüle eines tropischen Settings heraus geboren werden konnte. Das ist die Welt von Sweat of the Sun, dem Flaggschiff der diesjährigen Biennale.
Der erste Schritt in die Muffathalle ist ein Schritt in diese Welt. Die Intensität des Dschungels wird physisch erlebbar, gleich zu Anfang. Es ist nicht nur der Raum, das Licht, die Musik, die uns hineinziehen in die Strömung der Stimmung, sondern auch die Art und Weise, wie sich die Akteur*innen darin bewegen, in dieser fast unheimlichen Atmosphäre. Blicke liegen schwer aufeinander, gehen auch ins Publikum, durchdringen und überprüfen voller Misstrauen (– die Angst vor dem Messer im Rücken). Die Luft ist gespannt wie die Saiten der Streicher und von allen Seiten Gesang; aus dem Nichts, im Dialog mit den Anderen, aber eben auch mit sich selbst: immer wieder Caruso. An den Wänden zieht dazu der Dschungel vorbei, sodass es nur noch eine Richtung gibt und die heißt flussabwärts. Und wir sind mittendrin. Wir hören, worüber gesprochen wird. „Der Urwald ist obszön.“ So auch sein Gewitter, seine Insekten und Termiten. Das findet Form in flattrigen Geigen, zitternden Bögen – klebrige Flügelschläge surrender Stechmücken? Wir spüren den Schweiß, wir sehen ihn und ein bisschen kann man ihn auch riechen. Das ist der Schweiß der letzten vorbereitenden Tage. Nicht Angst, sondern Anstrengung, Energie, Begeisterung und Drive liegen darin. Und man spürt in der Musik der Produktion, aber auch draußen, unter dem noch blauen Abendhimmel: es wird einen Regen geben, der uns vom Schweiß befreit. Das gehört schließlich dazu, zur Frische des Anfangs. Ja, zu Beginn der Biennale riecht es verdächtig nach Anfang.